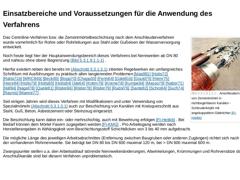
|
Einsatzbereiche und Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens |

|
|
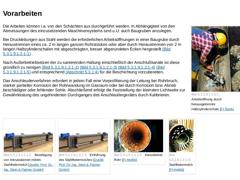
|
(Bild: Arbeitsöffnung durch herausgetrennte Halbzylinderschale [FI-Teerb])
Die Arbeiten können i.a. von den Schächten aus durchgeführt werden. In Abhängigkeit von den Abmessungen des einzusetzenden Maschinensystems sind u.U. auch Baugruben anzulegen.
Bei Druckleitungen aus Stahl werden die erforderlichen Arbeitsöffnungen in einer Baugrube durch Heraustrennen eines ca. 2 m langen ganzen Rohrstückes oder aber durch Heraustrennen von 2 m langen Halbzylinderschalen … |
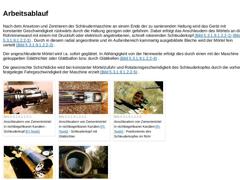
|
Nach dem Ansetzen und Zentrieren der Schleudermaschine an einem Ende der zu sanierenden Haltung wird das Gerät mit konstanter Geschwindigkeit rückwärts durch die Haltung gezogen oder gefahren. Dabei erfolgt das Anschleudern des Mörtels an die Rohrinnenwand mit einem mit Druckluft oder elektrisch angetriebenen, schnell rotierenden Schleuderkopf (Bild 5.3.1.9.1.2.2) (Bild 5.3.1.9.1.2.2) . Durch in diesem radial angeordnete und im Außenbereich kammartig … |
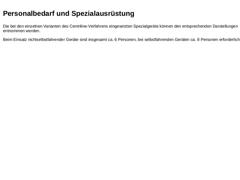
|
Die bei den einzelnen Varianten des Centriline-Verfahrens eingesetzten Spezialgeräte können den entsprechenden Darstellungen entnommen werden. Beim Einsatz nichtselbstfahrender Geräte sind insgesamt ca. 6 Personen, bei selbstfahrenden Geräten ca. 8 Personen erforderlich. |
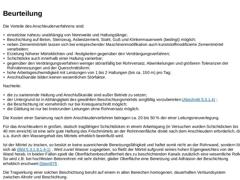
|
Die Vorteile des Anschleuderverfahrens sind: -
einsetzbar nahezu unabhängig von Nennweite und Haltungslänge;
-
Beschichtung auf Beton, Steinzeug, Asbestzement, Stahl, Guß und Klinkermauerwerk (bedingt) möglich;
-
neben Zementmörteln lassen sich bei entsprechender Maschinenmodifikation auch kunststoffmodifizierte Zementmörtel verarbeiten;
-
Erzielung höherer Mörteldichten und -festigkeiten gegenüber den Verdrängungsverfahren;
-
Schichtdicke auch innerhalb …
|

|
Bei dieser Verfahrensgruppe wird als Beschichtungsstoff zur Zeit vorwiegend zweikomponentiges Polyurethanharz mit Hilfe von Spezialschleuderköpfen auf die Rohrinnenwand in Schichtdicken von 5 bis 30 mm in einem Arbeitsgang ohne Nachglättung geschleudert. Die Arbeiten erfolgen nach Oberflächenvorbehandlung entsprechend Abschnitt 5.3.1.4 vom Einsteigschacht aus.
Vertreter dieser Verfahrensgruppe sind - CSL Polyspray (Abschnitt 5.3.1.9.2.1) ,
- Twin-Line (…
|

|
Das CSL Polyspray-Verfahren wurde 1984 in England für die Beschichtung von Kanälen im Nennweitenbereich von DN 225 bis DN 1000 entwickelt [FI-Costa] .
Die Schleudermaschine weist drei Hauptelemente auf: -
Mischkammer,
-
Gelierstrecke,
-
Schleuderkopf mit dem Antriebsmotor.
Die beiden Komponenten des Polyurethanharzes werden getrennt bis zur Mischkammer gepumpt und dort durch einen eingebauten Statikmischer aus Kunststoff intensiv vermischt.
Zwischen …
|

|
Das
Twin-Line-Verfahren
ist dadurch charakterisiert, daß die beiden Harzkomponenten (Polyurethan) nicht mehr durch separate Leitungen zur Anschleudermaschine gepumpt werden, sondern in entsprechend großen Vorratsschläuchen vorab werkseitig eingefüllt sind.
Die Länge der Vorratsschläuche entspricht der zu sanierenden Kanallänge; der Durchmesser wird bestimmt von der notwendigen Polyurethanmenge als Funktion von Schichtdicke, Rohrnennweite und Mischungsverhältnis.
|
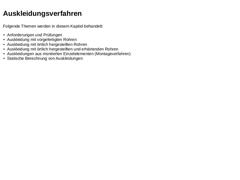
|
(Bild: Einteilung der Auskleidungsverfahren)
Die Auskleidungsverfahren (Rohrstrang-, Langrohr-, Kurzrohr-, Verformungs-, Reduktions-, Wickelrohr-, Schlauch- und Noppenschlauchverfahren) und die Montageverfahren werden nachfolgend unter den Verfahrensgruppen -
Auskleidung mit Rohren und
-
Auskleidung mit montierten Einzelelementen (Montageverfahren) in Form von
-
Teilauskleidungen des Sohlenbereichs oder des Gasraumes und
-
Vollauskleidungen
behandelt |

|
Für die nachträgliche Auskleidung von Abwasserkanälen und -leitungen können nach ATV-M 143 Teil 3 [ATVM143-3] grundsätzlich alle für Abwasser geeigneten Werkstoffe verwendet werden.
Die Anforderungen an den Auskleidungswerkstoff ergeben sich aus den Betriebsbedingungen. Diese werden im wesentlichen von den abgeleiteten Medien sowie von Planung, Konstruktion und Betrieb des Kanals beeinflußt [DIBt96] :
Auskleidungen müssen weitgehend undurchlässig …
|

|
Die Konstruktion der Auskleidung hat unter Berücksichtigung der vom Hersteller zu liefernden Verarbeitungsrichtlinien, Hinweise für Transport, Lagerung und Verarbeitung zu erfolgen, so daß unter Berücksichtigung der jeweiligen Werkstoffeigenschaften keine Beeinträchtigungen oder Schäden eintreten [DIBt96].
Auskleidungen müssen auch die Bereiche der Rohrverbindungen (z.B. Muffe und Spitzende) sicher abdecken. Sie dürfen nachträgliche Anschlüsse … |
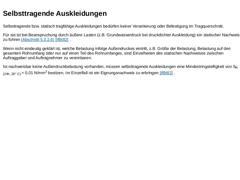
|
Selbsttragende bzw. statisch tragfähige Auskleidungen bedürfen keiner Verankerung oder Befestigung im Tragquerschnitt.
Für sie ist bei Beanspruchung durch äußere Lasten (z.B. Grundwasserdruck bei druckdichter Auskleidung) ein statischer Nachweis zu führen (Abschnitt 5.3.2.6) [IfBt82] .
Wenn nicht eindeutig geklärt ist, welche Belastung infolge Außendruckes eintritt, z.B. Größe der Belastung, Belastung auf den gesamten Rohrumfang oder nur auf einen … |
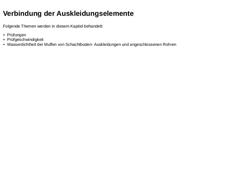
|
Wird die Auskleidung aus einzelnen Elementen hergestellt, so muß deren Verbindung untereinander (z.B. durch Kleben, Schweißen) sinngemäß den gleichen Anforderungen genügen wie die Auskleidung selbst.
Bei den Verbindungen dieser Elemente wird unterschieden zwischen Verbindungen ohne mechanische Beanspruchung und solchen mit mechanischer Beanspruchung.
Verbindungen ohne mechanische Beanspruchung sind in der Regel solche, die in Längsrichtung der … |
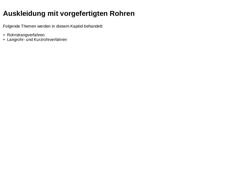
|
(Bild: Einteilung der Auskleidungsverfahren)
Die Auskleidung mit vorgefertigten Rohren ist charakterisiert durch das Einziehen, Einschieben oder Einfahren von Rohren (auch Lining-Rohr genannt) in die zu sanierende Haltung.
Es werden folgende Verfahren unterschieden (Bild 5.3.2.2) : - Auskleidung mit Rohrstrang (Rohrstrangverfahren) (Abschnitt 5.3.2.2.1)
- Auskleidung mit Langrohren (Langrohrverfahren) (Abschnitt 5.3.2.2.2)
- Auskleidung mit Kurzrohren (…
|

|
Bei diesen Verfahren wird ein entsprechend langer, flexibler und in den Stößen verschweißter Kunststoffrohrstrang aus PE-HD oder PP (in Einzelfällen auch PVC-U, dann aber unverschweißt), dessen Außendurchmesser bzw. maximale Außenabmessung kleiner ist als die kleinste in der Haltung vorkommende lichte Weite, in einem Arbeitsgang über Baugruben oder Schächte in den zu sanierenden Kanalabschnitt (mindestens eine Haltung) eingezogen. |
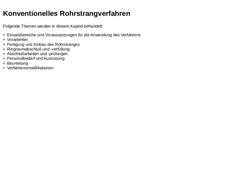
|
Das konventionelle Rohrstrangverfahren (in der deutschsprachigen Literatur oft als Rohrstrang-Relining bezeichnet) wurde in den 60er Jahren in Kanada unter der Bezeichnung "Bremner-Verfahren" entwickelt [Bremn71] [Bremn81] [Gale81b] [Quele81] [Cox81] [WPCFFD6] [Glenn82] [NASSCO85a] [WPCF85] [NASSCO85b] [Schro85] [WRC84a] [Stein89c] [Ewert91] [Stein86e] [Stein87e] [Stein87f] [Stein88f] [Stein88h] [Stein91c] ; es ist in den USA genormt [ASTMF58594] .
|
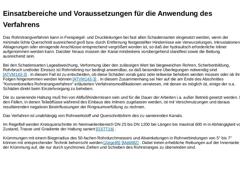
|
Das Rohrstrangverfahren kann in Freispiegel- und Druckleitungen bei fast allen Schadensarten eingesetzt werden, wenn der minimale lichte Querschnitt ausreichend groß bzw. durch Entfernung festgestellter Hindernisse wie Verwurzelungen, Inkrustationen, Ablagerungen oder einragende Anschlüsse entsprechend vergrößert worden ist, so daß der hydraulisch erforderliche Inliner aufgenommen werden kann. Darüber hinaus müssen der Kanal mindestens vorübergehend … |

|
| (Bild: Konventionelles Rohrstrangverfahren mit Ringraum [FI-Teerb] - Blick auf eine Einziehbaugrube mit Rohrstrang) | | (Bild: Ermittlung der Abmessung der Einziehbaugrube - Länge der Einziehbaugrube bei zwangsgeführtem, nicht angehobenem Rohrstrang [Zimme91]) | | (Bild: Ermittlung der Abmessung der Einziehbaugrube - Biegekurve des um das Maß H angehobenen Rohrstranges [Zimme91]) | | (Bild: Ermittlung der Abmessung der Einziehbaugrube bei elastischer Einspannung [… |
|
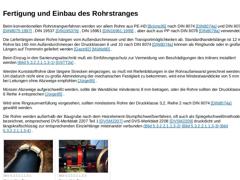
|
Beim konventionellen Rohrstrangverfahren werden vor allem Rohre aus PE-HD [Bröms95] nach DIN 8074 [DIN8074a] und DIN 8075 [DIN8075:1997] , DIN 19537 [DIN19537b] , DIN 16961 [DIN16961:1999] , aber auch aus PP nach DIN 8078 [DIN8078a] verwendet.
Die Lieferlängen dieser Rohre hängen vom Außendurchmesser und den Transportmöglichkeiten ab. Standardhandelslänge ist 12 m. Rohre bis 160 mm Außendurchmesser der Druckklassen 6 und 10 nach DIN 8074 [DIN8074a] … |
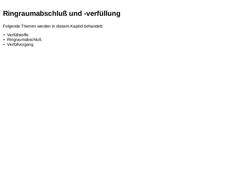
|
Ringraumabschluß und -verfüllung beim Rohrstrangverfahren |
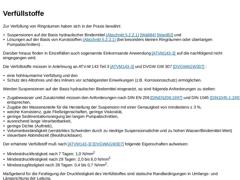
|
Zur Verfüllung von Ringräumen haben sich in der Praxis bewährt: - Suspensionen auf der Basis hydraulischer Bindemittel (Abschnitt 5.2.2.1) [Walli84] [Ward82] und
- Lösungen auf der Basis von Kunststoffen (Abschnitt 5.2.2.1) (bei besonders kleinen Ringräumen oder überlangen Pumpabschnitten) .
Darüber hinaus finden in Einzelfällen auch sogenannte Einkornsande Anwendung [ATVM143-3] auf die nachfolgend nicht eingegangen wird.
Die Verfüllstoffe müssen in …
|

|
Vor Beginn des Verfüllvorganges sind, wenn nicht bereits im Zuge der Inlinerverlegung erfolgt, Anfang und Ende des Ringraumes bzw. Verfüllabschnittes an den Schächten und den Seitenzuläufen so fachgerecht zu verschließen, daß der Verfülldruck aufgenommen werden kann und die Kontrolle des Verfüllvorganges ermöglicht wird. Der Inliner ist zur Vermeidung von Lageänderungen gegen Auftrieb zu sichern [ATVM143-3] .
Die Verbindung der Rohrstränge in der …
|
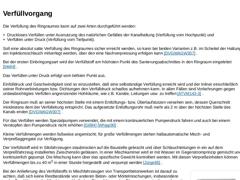
|
Die Verfüllung des Ringraumes kann auf zwei Arten durchgeführt werden: - Druckloses Verfüllen unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles der Kanalhaltung (Verfüllung vom Hochpunkt) und
- Verfüllen unter Druck (Verfüllung vom Tiefpunkt).
Soll eine absolut satte Verfüllung des Ringraumes sicher erreicht werden, so kann bei beiden Varianten z.B. im Scheitel der Haltung ein Injektionsschlauch mitverlegt werden, über den eine Nachverpressung erfolgen kann [… |

|
Abschlußarbeiten und -prüfungen beim Rohrstrangverfahren |