
|
Jan 23, 2018
News
egeplast international GmbH
As of 1 January 2018, the manufacturer of plastic pipes, egeplast will be joined by 46-year-old sales expert Christian Haferkamp as general manager of sales. His responsibilities also include product management and marketing.
|

|
Jan 24, 2018
News
Donna Alston
Aqua America’s Chief Environmental Officer Chris Crockett has been appointed to the Commonwealth of Pennsylvania’s Lead Task Force Advisory Committee, established by the Joint State Government Commission, the primary non-partisan research and policy development agency for Pennsylvania’s General Assembly. Meanwhile, Aqua America has welcomed more than 7,100 new customers through organic growth and approximately 1,000 more through four completed acquisitions through the end of Q3 2017.
|

|
Jan 18, 2018
News
Prof. Dr. Tom Iseley
The Trenchless Technology Center (TTC) at Louisiana Tech University (LA Tech) is pleased inform you that we are partnering with the ASCE UESI (Utility Engineering and Surveying Institute) and the National Utility Contractors Association (NUCA) to offer the 2nd UIS. This 5-day TTC Specialty School will focus on the ASCE 38-02 Standard Guideline for the location and depiction of underground utilities.
|
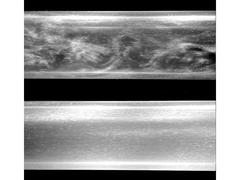
|
Jan 30, 2018
News
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)
Until now it had been assumed that, once a flow of a fluid has become turbulent, turbulence would persist. Researchers at the Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) including Professor Björn Hof and co-first authors Jakob Kühnen and Baofang Song have now shown that this is not the case.
|

|
Jan 31, 2018
News
WPL Limited
Work is underway on three UK utility framework contracts awarded to packaged wastewater treatment specialist WPL, two by United Utilities (UU) and one by Anglian Water.
|

|
Feb 01, 2018
News
Juniper Systems
Juniper Systems, Inc. and ProStar Geocorp® have recently joined forces to produce an affordable, efficient solution for capturing precise cable and pipe locating data. Combining Juniper Systems’ Cedar CT7G Rugged Tablet and Geode Sub-meter GPS Receiver with ProStar’s patented Pointman® software, utility locate professionals are equipped with a powerful, yet user-friendly underground utility locate solution.
|

|
Feb 02, 2018
News
Borealis AG
Access to water and sanitation is a basic human right. However, the United Nations (UN) estimates that at least 1.8 billion people have to drink water contaminated with faeces, while 2.4 billion people lack basic sanitation such as toilets or latrines. This contributes to nearly 1,000 children dying each day due to preventable diseases and is a major hurdle for the development of both people and nations.
|

|
Feb 07, 2018
News
Intertek
Intertek, a leading Total Quality Assurance provider to industries worldwide, is pleased to unveil a new pipeline quality verification solution, Intertek PipeAware, offering pipeline owners digital access to pipeline integrity data which is vital for assurance and compliance purposes.
|

|
Feb 15, 2018
News
Banyan Water
Water-first IoT platform also adds notable campuses and REITs to growing portfolio.
|

|
Feb 09, 2018
News
Fluence Corporation Limited
Fluence Corporation Limited announced that it has been awarded Frost & Sullivan’s 2018 Global Company of the Year Award for decentralized water and wastewater treatment.
|

|
Nov 20, 2017
News
The Robbins Company
Landmark Conveyor revs up Akron OCIT Muck Removal.
|

|
Nov 21, 2017
News
WiseOnWater
Two leading water sector organisations have signed a memorandum of understanding (MoU) to enhance collaboration around innovation and market trends. Technology market intelligence company BlueTech Research and the Water Environment Federation (WEF) aim to identify multiple opportunities to combine expertise and meet shared goals for the water industry.
|

|
Nov 22, 2017
News
Kit Jones
Quadex, LLC recently announced that its GeoKrete Geopolymer meets the most demanding European test standard for corrosion resistance, WXX4, as defined by DIN 19573: Mortar for Construction and Rehabilitation of Drains and Sewers Outside Buildings.
|

|
Nov 23, 2017
News
Watts Water Technologies, Inc.
Watts Water Technologies, Inc. announced its sponsorship of two water filtration systems (AquaTowers) to provide clean drinking water to residents in remote areas of Puerto Rico.
|
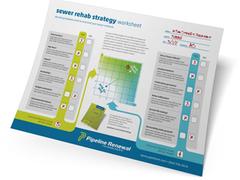
|
Nov 24, 2017
News
Envirosight LLC
Worksheet provides a graphical method for determining whether to utilize spot repair or end-to-end in a given application.
|

|
Sep 17, 2018
News
Ditch Witch
New machine boosts productivity and power, maximizes visibility and comfort.
|

|
Sep 18, 2018
News
Thomas Mavridis
The Supervisory Board of the global REHAU Group announces that William Christensen was appointed the new CEO of REHAU.
|

|
Sep 19, 2018
News
Plastic Pipes Conference Association (PPCA)
Organizers of Plastic Pipes XIX announce that INFORMED INFRASTRUCTURE is a Media Sponsor of the forthcoming conference and exhibition that will take place in Las Vegas, Nevada USA, at the Red Rock Resort on September 24 – 26, 2018.
|

|
Sep 20, 2018
News
Herrenknecht AG
In late July the moment has come: tunnel boring machine "SUSE" (Ø 10,820 mm) has completely excavated the western tube of the Filder Tunnel. Now, in a specially built cavern, the approximately 120 meter long Multi-mode TBM from Herrenknecht is disassembled into individual parts and turned around underground. From the fall of 2018 it is due to commence excavation work in the remaining 3.4 kilometer section of the eastern tube.
|
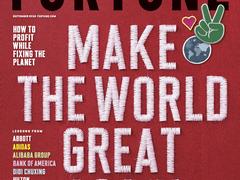
|
Sep 25, 2018
News
Kelly McAndrew
Xylem is among the Top 50 companies recognized for significant social impact.
|

|
Sep 26, 2018
News
Jessica Maier
Two powerful brands make an even more powerful solution: A combination of filament wound Flowtite and centrifugally cast Hobas pipes by Amiblu is being installed to build a new, highly efficient stormwater sewer system for Kraków Airport. The new underground infrastructure is an important cornerstone for the airport’s increasing importance in international aviation.
|

|
Sep 27, 2018
News
Lianne Ayling
Hampshire-based WPL has won three supplier framework contracts for wastewater treatment plant and equipment with public utility Scottish Water. The contracts cover both hire and purchase agreements and the first hire plant has already been installed at Winchburgh, a fast-growing £1 billion residential development 11 miles west of Edinburgh.
|

|
Oct 01, 2018
News
Achim Kühn
For the modernization of a wastewater treatment plant near Auckland, innovative Direct Pipe® technology is in use to install a sea outfall pipeline. Over 1,930 meters, the machine is tunnelling its way through the New Zealand subsoil into the sea. That's a world record. The new sea outfall not only increases the plant's capacity, but also sets a new distance world record with Direct Pipe® technology.
|

|
Oct 02, 2018
News
Woolpert
Woolpert was contracted by the city of South Bend, Ind., to implement the Cityworks Asset Management System (AMS) for the Department of Public Works’ Office of Sewers.
|

|
Oct 03, 2018
News
US Pipelining LLC.
Cured-In-Place Pipe Liner Provides Seamless and Structural Restoration Over Major Waterway.
|